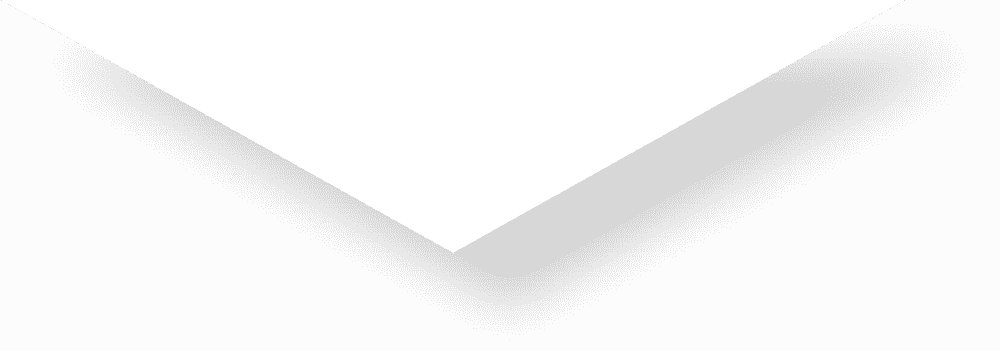Unterscheiden
„Mensch sein“, „menschlich“, „Es menschelt“… Was DAS MENSCHLICHE ausmacht, ist mir immer weniger klar. Offenbar reklamiert jeder Mensch, „menschlich“ zu sein – was erst einmal plausibel klingt. Im gleichen Atemzug wird aber gerne anderen Menschen unterstellt, un-menschlich zu sein. Noch krasser wird es, wenn es um DAS CHRISTLICHE geht. War es lange uninteressant, noch über das Christliche nachzudenken, so haben Pegida und Co im Zuge der Flüchtlingswelle das Christliche im Zusammenhang mit dem sogenannten „Abendländischen“ als Gegensatz zum Islam entdeckt.
Interessant ist, dass ausgerechnet Christen zu den schärfsten Gegnern dieser anti-islamischen Bewegung gehören – zu recht! Mir scheint, bei der Verwendung des Attributs „menschlich“ greift ein ähnlicher Mechanismus: Um seinen eigenen Vorstellungen Gewicht zu verleihen, sucht man ein positiv besetztes, aber möglichst unscharfes Attribut, um die Position als positiv, aber selbstverständlich unbefragbar erscheinen zu lassen. Als Menschen sollten wir Vorsicht walten lassen, wenn es um unser Innerstes, um unser Eigenstes geht. Wir sollten die Geister unterscheiden. Als Christen sollten wir wissen, dass uns eine
besondere Sicht des Menschen gegeben ist, dass wir bei aller Relativität der Positionen eine Kultur leben, die uns von anderen unterscheidet und für andere Menschen hilfreich ist. Erinnern wir uns kurz daran, welchen Weg wir zurückgelegt haben, woher wir unsere jetzige Kultur nehmen.
Ein kurzer Blick zurück
Noch im Zweiten Vatikanischen Konzil vor 50 Jahren war sich die Katholische Kirche sicher, dass die christliche Lebensauffassung die innerste Bestimmung des Menschen, wirklich jedes Menschen abbildete. Jeder Mensch guten Willens sei, so das II, Vaticanum, ein „anonymer Christ“. Deshalb konnte die junge Bundesrepublik ohne weiteres den konfessionell verantworteten christlichen Religionsunterricht – nicht nur den katholischen – problemlos in die staatlichen Schulen integrieren, trotz der Trennung von Kirche und Staat. Aus damaliger Sicht war das richtig, gerade auch wenn damals schon die Menschen den Kirchen davonliefen. Die Religionslehrer brachten den Menschen das Ur-Menschliche, und damit eben das Christliche bei. Wo war da das Problem? Man missionierte ja nicht, die Unterscheidung zwischen Glaubensunterweisung in der Gemeinde und Religionsunterricht in der Schule war eindeutig (außer im Erzbistum Paderborn).
Dann kam die Kritische Theorie und entlarvte diese eigentlich idealistische und wohlmeinend tolerante Position als globalen Machtanspruch, ja als „Eingemeindung“ der bewusst nicht christlich lebenden Menschen in den kirchlichen Einflussbereich. Atheisten wehrten sich und bestritten öffentlich, „anonyme Christen“ zu sein. Und in der Praxis zeigt es sich, dass die „Rechnung“ dieser toleranten Haltung (modern = attraktiv) auch nicht aufging. Die Menschen kamen nicht mit fliegenden Fahnen zurück zu dieser modernen, toleranten Kirche, sondern gingen ihrer Wege.
Innerhalb der Kirche kam es zu einer Rückwärtsbewegung. Karl Rahner sprach in den 1980er Jahren von einer „winterlichen Kirche“. Parallel zum nachlassenden Fortschrittsoptimismus in der säkularen Welt verkrampften auch die christlichen Kirchen in ihrem Reformeifer. Nun kam es wieder mehr auf die bekundete Zugehörigkeit zu einer Gemeinde als auf die bloße christliche Gesinnung an. Christ war man nun eher durch Zugehörigkeit (Taufe, ehrenamtliche Mitarbeit, …) als durch Gesinnung oder Lebensführung.
Grund zur Resignation? Man könnte meinen, danach habe sich das Menschenbild einfach nur pluralisiert, sei zersplittert und lasse sich etwa in einer Grafik wie denen der Sinusstudie (www.sinus-institut.de) vielgestaltig abbilden. Man könnte meinen, die Prägekraft des christlichen Menschenbildes sei dahin – das traditionelle Familienbild löse sich auf, Werte-Orientierung trete immer weiter hinter ein hedonistisches Ideal von „Lebensqualität“ zurück, Ehrenamt und altruistische Lebensideale gingen den Bach hinunter, Religion verflüchtige sich in vage, bindungslose Weltanschauungen.
Man könnte sogar meinen, die Kirchen wickelten sich bereits selbst ab: Kirchen werden geschlossen, ungewidmet, verkauft und abgerissen. Klare Konzepte und zielstrebige Reformen, die die Grundvollzüge kirchlichen Lebens hierzulande wirklich sichern, gibt es nicht. Bischöfe und Superintendenten reisen über Land, um den Gläubigen ihre Notstandsgesetze näher zu bringen. Viele Gemeinden flüchten sich in Riten, lassen problematische (Rand?-) Gruppen wie Jugendliche,
Behinderte, im Leben Gescheiterte fallen und trennen sich – mangels ehrenamtlichen Engagements und finanziellen Spielräumen – von zentralen Aufgaben wie der Caritas, dem Krankenbesuchsdienst, Beratungsstellen und langsam auch Kindergärten und Schulen. Ein Desaster?! In vielen Gemeinden ist die Stimmung ziemlich am Boden.
Blick über den Tellerrand: Perspektivenverschiebung
Ein junger Priester aus Ruanda studiert in Leuwen (Belgien) Theologie mit dem Ziel, in Zimbabwe eine theologische Fakultät aufzubauen. Das Thema seiner Doktorarbeit ist: Die Kritische Theorie in der pastoralen Praxis in Afrika. Was? Kritische Theorie? Diese marxistisch inspirierte Lehre, jener Erzfeind, der den katholischen Aufbruch der Siebziger Jahre stoppte? Seine Mitbrüder, selbstbewusste franziskanische Missionare in Ostafrika, gehen ebenfalls einen anderen Weg als die europäischen Mitbrüder bisher. Sie sagen nicht mehr: „Jeder Cent, den ihr Europäer spendet, kommt in Afrika an. Ihr seid die, die Gutes tun, wir sind nur die Ausführenden. Wir helfen nur. Wir selbst sind unwichtig.“ Sie sagen stattdessen: „Wir sind die Ausführenden. Nur wenn ihr uns helft, dann helft ihr der jungen afrikanischen Kirche, auf die Füße zu kommen. Und wenn ihr der Kirche helft, dann helft ihr den Menschen effektiv.“
Dieses erfrischende, gleichwohl stimmige und nicht subtil vereinnahmende Selbstbewusstsein der afrikanischen Brüder einmal selbst zu erfahren, das wünsche ich so vielen traurigen Christen in unseren Gemeinden! Mir jedenfalls hat es Mut gemacht. Die Sozialisation der afrikanischen Brüder ist die der Kriege, des Hungers, der Not. Sie haben darin erfahren, dass (nur) Kirche ihnen geholfen hat, eine Perspektive für ein menschliches Leben aufzubauen. Sie haben keine allgemeine „Kultur“, keine unbefragbare „Tradition“, schon gar keine „Volkskirche“. Auf meine Frage, wie sich die Kritische Theorie mit Pastoraltheologie vertrage, kommt die erstaunte Rückfrage, wie man überhaupt ohne eine kritische Unterscheidung der Machtverhältnisse eine Pastoral aufbauen könne? Wie will man für Menschen da sein, wenn man keine Worte und Theorien für ihre Nöte und die Missstände hat?
Rückblick, zweiter Teil
In den Neunziger Jahren erlebten wir – wieder parallel in Staat und Kirche – eine gefühlte Professionalisierung. Man vertraute lieber „Experten“ statt langwierigen demokratischen Prozessen. Das funktionierte – auch in den mittlerweile teil-demokratisierten Kirchen – nur über den Kniff der instrumentalisierten „Wissenschaft“. Visionen, die zuvor an Runden Tischen entworfen worden waren, wurden nun in meist anonymen, para-demokratischen Strukturen umgesetzt und führten in Kirche und Politik zur Entfremdung mit dem Volk, den – Ihr ahnt es schon – „Menschen“. Der Mensch, das war nun der Gegensatz zur Institution, und zwar nicht als einer, der sich auflehnt gegen Bevormundung, sondern eher als der Resignierte, der sich eine Nische mit möglichst viel „Lebensqualität“ sucht.
Wo gab es das große Aufbegehren gegen die Agenda 2010? Gegen Hartz IV? Gewerkschaften, ok… Aber die Mehrheit der Gesellschaft zuckte mit den Schultern. Die politischen Prozesse in Staat und Kirche waren in dieser Zeit „alternativlos“ (eine Vokabel, die Angela Merkel mittlerweile am liebsten ungesagt wüsste). In den Kirchen wanderten nun vor allem die aus, die vorher am engagiertesten mitgearbeitet und ihr ganzes Herzblut in den Aufbruch gesteckt hatten.
Wenn man genauer hinsieht, dann sieht man im Norden Duisburgs zum Beispiel, in Telgte oder auch in Bochum Gemeinden, die ihre Arbeit, ihr Gemeindeleben vor Ort nicht einfach den zentralisierenden Notstandsgesetzen ihres Bischofs (euphemistisch „Pastoralplan“ genannt) opfern wollen. Diese wenigen Reaktionen ganzer Gemeinden haben eine andere Qualität, im Falle Duisburgs auch eine andere Effektivität, als das traurige Fortbleiben enttäuschter Gemeindemitglieder. Auch sie haben – woher eigentlich? – dieses Bewusstsein: Ohne uns geht es nicht! Wir sind die, die das Christsein weiter leben lassen, nicht irgendwelche großgemeindlichen Strukturen.
Und dann kamen schließlich 2015 die Flüchtlinge. Doch halt! 2015 spitzte nur etwas zu, was sich vorher schon lange abgezeichnet hatte: Die Pluralisierung der Gesellschaft, die Relativierung von Wert-Horizonten sucht plötzlich mit ungeahnter Macht ein Gegengewicht. Die Rechten kommen! Oder sollte man sagen: Die Pluralisierung sucht als Gegengewicht die Polarisierung?! Den „Experten“ wird mittlerweile öffentlich widersprochen. Politische Parteien handeln wieder kurzfristiger und orientieren ihre Programmatik hastig an Wahlergebnissen. Mit Argumenten kommst du als Politiker nicht mehr weit. Trends sind viel wichtiger.
Die Willkommenspolitik 2015 hatte einen merkwürdigen Beigeschmack (den Feuerwehren und Rettungskräfte schon längst kennen): Die Mehrheit der Bevölkerung will „menschlich“ sein und helfen, opfert Geld, Urlaub, Sicherheit, um die Not der ankommenden Flüchtlinge nicht nur formal zu lindern, sondern im Ganzen. Einer lautstarken Minderheit (Spiegel: bis zu 30% der Bevölkerung)
ist die Hilfe sekundär oder sogar egal, sie reklamiert die Gefährdung ihres eigenen Wohlstands, mehr noch: ihrer Identität durch die Fremden. Gerade in Gebieten, in denen bisher weniger „Menschen“ mit Migrationshintergrund lebten, brennen mehr Flüchtlingsunterkünfte nieder als in Berlin oder im Ruhrgebiet.
Die Willkommenskultur 2015 ist keine konzertierte Aktion von Christen. Aber man konnte nicht nur überproportional viele aktuell aktive Christen dort wiederfinden; es kamen auch ehemalige Kirchenchristen dazu, die endlich wieder die Möglichkeit sahen, ihre Lebensideale hier zu leben. Hier kam es eben nicht auf den Taufschein an, sondern schlichtweg darum, ob man helfen wollte und konnte oder nicht.
Ob das berühmte Wort von Merkel „Wir schaffen das“ die Flüchtlinge auf die Reise geschickt hat, bezweifle ich. Das war wohl eher die Nachricht eines Mitarbeiters des World Food Program an die großen Flüchtlingslager in der Türkei, dem Libanon und in Jordanien, die Lebensmittel dort gingen im Juni zu Ende, weil die Industriestaaten ihre zugesagten Zahlungen erst in der zweiten Jahreshälfte leisten wollten. Auf jeden Fall markiert dieses Wort aber den Leitsatz der Hilfs- und Willkommenskultur 2015. Dieses Wort war natürlich utopisch.
Genauso utopisch, wie damals in der Bundesrepublik das Autokennzeichen L für Leipzig reserviert wurde für den Fall, dass Deutschland einmal wiedervereinigt würde. Spannend an dieser ersten kleinen Utopie des 21. Jahrhunderts war aber die Bereitschaft der Beteiligten, das mögliche, sogar eher wahrscheinliche eigene Scheitern in Kauf zu nehmen.
Was hat es denn am Ende gebracht, am Bahnhof den Flüchtlingen zuzuwinken, einem Kind einen Teddybär in die Hand zu drücken, ein Transparent „Willkommen! Welcome!“ zu malen und hochzuhalten, du naiver Gutmensch? Menschlichkeit ist keine austauschbare Worthülse.
Ja, das frage ich mich manchmal auch. Ich lasse meine Unsicherheit zu, meine Fragen und Zweifel. Vielleicht unterscheidet uns das. Ich hoffe es nicht, aber möglicherweise ist es so. Ich mache mich angreifbar, verletzbar, wenn ich anderen Menschen sage: Du schaffst das! Oder: Wir schaffen das! Und mehr noch: Ich schaffe es oft selbst nicht, diesen Glauben durchzuhalten. Mein Glauben ist oft zu schwach. Deshalb brauch ich einen Halt. Deshalb brauche ich Menschen.
Und weil das im Extremen, im Endeffekt auch nicht reicht, deshalb brauche ich Gott. Ja, ich bekenne mich dazu: Ich bin nicht so stark als Mensch, dass ich ohne Gott auskommen kann. Ich halte mir aber zugute – nach den Erfahrungen meiner bisherigen 56 Jahre –, dass mich das nicht nur verletzbar, sondern gerade deshalb auch nahbar macht. Ich bin nicht der Macher, der Experte, der Wissende, der
Souveräne, der alles beherrscht. Und gerade deshalb bin ich Mensch, deshalb bin ich für Kinder, Jugendliche, Alte, Frauen, Männer, Ausländer, Nachbarn und zufällige Begegnungen ansprechbar.
Ich mag es, mit jedem Menschen in Kontakt zu treten, ihn kennen zu lernen. Wenn ich einen Text schreibe, dann stelle ich mir einen konkreten Menschen vor, für den ich schreibe. Wenn ich ein Lied schreibe oder singe, dann stelle ich mir einen konkreten Menschen vor, ob ihr oder ihm das gefallen würde. Wenn ich ein Bild male, dann suche ich meine eigenen Erfahrungen mit der Welt und ihren Menschen darin wiederzufinden.
Menschlichkeit ist für mich gleichzeitig unendliches Potenzial und Vielfalt und zugleich (hoffentlich sympathische, nicht selbstverliebte) Unvollkommenheit. Für mich hat sich das Menschliche im Christlichen wunderbar entfaltet; Bibel und Lehre der Kirche – so wünsche ich es mir zumindest nach meiner bisherigen Lebensgeschichte – sollten mir Halt und Weisung sein, in einer Vielfalt und Differenzierung, wie sie ein einzelner Mensch sich selbst nicht aufbauen kann.
Christsein wird ein Ärgernis bleiben Während das Menschliche das Einende, Verbindende ist, wird das Christliche (mir) – obwohl wie geschildert zutiefst mit dem Menschlichen verbunden – das Unterscheidende und damit das Ärgerliche bleiben. Und damit meine ich nicht die Gottesfrage. Bei der Gottesfrage kann ich – vor allem als Theologe und Lehrer – immer noch in gewisser Weise Experte sein. Ich kann argumentieren. Die spitzen und teilweise ätzenden Argumente der Neuen Atheisten zum Beispiel finde ich nicht wirklich ärgerlich oder provozierend, teils selbstverständlich, teils oberflächlich.
Viel schwieriger ist und bleibt die Frage, wie ich als moderner Mensch einem historischen (!) Menschen, der vor 2000 Jahren gelebt und selbst nichts hinterlassen hat außer seinem gewaltsamen Tod, anhängen kann, ihn zum obersten Ratgeber meines Lebens machen kann. Jesus von Nazaret,
im Glauben genannt: Christus, Gesalbter Gottes, er, der schon durch die biblischen Evangelien, die Briefe des Paulus und andere Bücher des NT vielfach gebrochen gespiegelt wurde, wie kann ein solcher Mensch mir Christus sein, quasi deus?
Ich, der ich nicht nur allgemein moderner Mensch bin, sondern durch mein Studium auch besonders gebildet und durch die Kritische Theorie insbesondere geschult sein sollte, die Brechungen von Ideen durch Machtverhältnisse zu kennen – wie kann ich heute noch Christ sein?
Ich kann. Aber nicht allein. Nicht ohne euch. Nicht ohne Gott. Nicht ohne ihn.
Ich bin nicht der Experte, der erklären kann, wie Glauben oder gar Menschsein geht. Ich kann nur versuchen, mich immer wieder darauf einzulassen.
Ist das nicht arm? Vielleicht. Christus war auch arm. Vielleicht. Als Mensch bin ich für alle ansprechbar, jedem, jeder nah. Als Christ bin ich für Nicht-Christen der (ärgerlich?) Andere, für Mit-Christen hingegen der unter dem Anspruch Christi Befragbare. Als Christ lege ich – hoch gesprochen – Zeugnis ab für Christus. Ich bekenne mich zu ihm. Ich werde aber immer mit denen, die sich auf Christus berufen, um seine Botschaft ringen, und in diesem Sinne das christliche Bild vom Menschen in die Waagschale werfen.