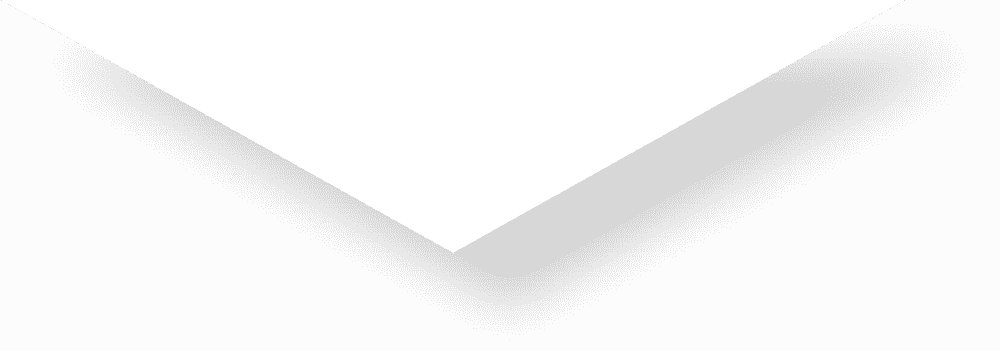Vortrag auf der Tagung des Politischen Arbeitskreises des ND: Über die Zeiten: Humanität, Freiheit, Frieden. Maria Laach, 4.-5. November 2022 (durchgesehene ungekürzte Fassung).
Anlässlich des Todes Elizabeths II. von England stellte ein Bekannter ein Wort ins Internet, das die verstorbene Königin wenige Wochen vor ihrem Tode von sich gegeben hatte:
Throughout my life, the message and teachings of Christ have been my guide and in them I find hope (3rd August 2022).
Ich kommentierte dies mit der Bemerkung:
In der ARD-Sondersendung anlässlich des Todes habe ich die religiöse Komponente im Leben der Queen schmerzlich vermisst.
Unerwarteter Weise erntete ich daraufhin den kritischen Hinweis:
ob die religiösen komponente gefehlt haben, ist denke ich nicht schlimm, denn religion rettet nicht. wenn sie geglaubt hat an jesus christus, dann darf sie das sehen, was sie glaubte (Willie Buntz, Facebook, 9.9.2022 – Originaldiktion)
Da hatte mir jemand in der Tradition der evangelisch-reformierten Theologie Karl Barths mit der kategorialen Unterscheidung menschengemachter „Religion“ von göttlicher „Offenbarung“ geantwortet. Abgesehen davon, daß es mir mit meiner Bemerkung nicht um das individuelle Seelenheil Elizabeths, sondern um die deutsche Fernsehberichterstattung gegangen ist, weist dieser Wortwechsel nicht nur auf ein Problem massenmedialer Darstellungen in Deutschland, sondern auch auf den Begriff der Religion hin.
Damit sind wir bei dem Zentralbegriff meines Themas, das ich in einem Dreischritt behandeln möchte:
- Erstens: Menschsein und Religion
- Zweitens: Grundlagen für das Verhältnis von Christen zur Politik
- Drittens: Konfessionelle Ausprägungen heute.
- Mensch und Religion
Religion scheint nicht nur derzeit keine gute Presse zu haben, sondern bei vielen Zeitgenossen auch keinen guten Ruf zu genießen. Die Religionskritik von Feuerbach, Marx oder Freud ist hinreichend bekannt, so daß sie hier nicht wiederholt zu werden braucht. Dagegen schrieb mir der Pastor, der mich vor einem halben Jahrhundert konfirmiert hat, im Anschluss an einen von mir verfassten Leserbrief in der Frankfurter Allgemeinen:
„Die Wichtigkeit von Religion ist für mich unbestritten und ich bin dankbar, wenn jemand dies betont. Nur Religion macht es uns möglich, in größeren Horizonten zu leben. Das kann die Philosophie nur bedingt“[1].
Daß ein Pastor wie Arnulf Michaelis, zeitweise Mitglied der „Projektgruppe Glaubensinformation“ des evangelischen Theologen Helmut Thielicke, den Wert der Religion betont, ist erwartbar. Doch stellt sich die Frage: Was ist das Besondere, das Eigentümliche, also das „Wesen“ von Religion?
Zwei vielleicht überraschende, womöglich sogar paradox klingende Bemerkungen dazu vorab:
Erstens: Der Begriff „Religion“ ist ein Allgemeinbegriff, der ein vielgestaltig konkretisiertes Phänomen bezeichnen soll. Er bezieht sich daher gerade nicht auf eine spezielle Ausprägung. Aber: Dieser Allgemeinbegriff ist im Raume des Christentums entstanden und insoweit gerade ein diesem Kulturkreis zugehöriger Begriff. Christoph Elsas erhärtet dies durch die Bemerkung: „Nur nachklassische westliche Sprachen besitzen überhaupt ein besonderes Wort für R[eligion] und trennen anders als andere Zivilisationen ‘religiöse’ von anderen kulturellen Manifestationen“ [2].
Zweitens: „Religion“ bezieht sich nach unserem Vorverständnis jedenfalls auf eine transzendentale Sphäre. Trotz seines gerade hervorgehobenen Hervorgehens aus dem christlich geprägten Kulturkreis gibt der Begriff eine Außensicht auf das Phänomen wieder. Die Perspektive von Glaubensgemeinschaften, die sich um eine subjektiv so verstandene göttliche Offenbarung zusammengefunden haben, wird nicht eingenommen. Der etwas Transzendentales bezeichnende Begriff „Religion“ ist daher ein anthropozentrisch geprägter Begriff[3].
Die in Theologie, Philosophie und Soziologie im Laufe der Jahrhunderte unternommenen Definitionsversuche sind vielfältig und ihrerseits wiederum vielfach kritisiert worden[4].
Nur beispielhaft geht es für Cicero bei religio um den korrekten Vollzug des „cultus deorum“, für die Kirchenväter Lactantius und Augustinus um die Rückbindung des Menschen an seinen Schöpfer, für Schleiermacher um ein Gefühl schlechthinniger Abhängigkeit[5]. Neuere Verständnisvarianten lassen sich in substantielle und funktionale unterteilen:
Substantiellem Verständnis entspricht eine Auffassung, die in einer Religion eine Begegnung des Menschen mit dem „Unbedingten“ oder – in Anknüpfung an Rudolf Otto: dem „Heiligen“ – sieht.
Funktionaler Auffassung gemäß wird Religion mit dem identifiziert, was sie real – also: weltimmanent – bewirkt. In diesem funktionalen Verständnis ist Religion daher mit allem verbunden, was man in der Gesellschaft mit einer Glaubensgemeinschaft in Verbindung bringen kann. Deren Selbstverständnis wird bei einer solchen Perspektive ausgeklammert[6].
Danach dürfte klar sein:
Erstens: Der Begriff „Religion“ greift weit über das Christentum hinaus. Er umfasst auch nicht nur monotheistische Glaubensrichtungen.
Zweitens: Das Analyseprogramm für das Phänomen „Religion“ hängt entscheidend von dem Vorverständnis beziehungsweise von der – durchaus reflektiert – gewählten Definition ab.
Hinsichtlich der erfassten Phänomene haben wir es mit einem Aspekt menschlicher Existenz zu tun, der in allen Kulturen und für alle Zeiten nachgewiesen werden kann. In der sorgfältigen Beisetzung Verstorbener, insbesondere ihrer Ausstattung mit Grabbeigaben, zeigt sich selbst für früheste Epochen der Menschheitsgeschichte ein Bewusstsein für etwas, das unsere irdische Existenz übersteigt. Mittlerweile sind bewusste Bestattungen selbst für Neandertaler nachgewiesen[7]. Die Rückführung von Religion auf ausbeuterische Gesellschaftsstrukturen, wie sie von Marxisten wie etwa Karl Kautsky vertreten worden ist[8], scheidet danach heute wohl aus. Vielmehr haben wir es mit einer anthropologischen Konstante zu tun, einer conditio humana.
Eine liberal-bildungsoptimistische Interpretation von Religion, als vernunftnotwendig auf der Basis eines „religiösen Apriori“ (Ernst Troeltsch)[9], wird der Gesamtheit des Phänomens allerdings nicht gerecht. Denn bei einem substantiellen Religionsbegriff haben wir auch die Lehren von Hochreligionen zum Umgang mit „Ungläubigen“ mit ins Kalkül ziehen, bei einem funktionalen Begriff darüber hinaus die vielfältigen kriegerischen Praktiken und Verfehlungen von Gläubigen.
- Biblische Grundlagen zur Haltung von Juden und Christen zur Politik
Die Begegnung mit dem Unverfügbaren, Heiligen, Numinosen ordnet die Religion der geistigen Sphäre zu, so daß sie von den gern „handfest“ genannten Konflikten in der Welt denkbar weit entrückt erscheint. Diese Sicht berücksichtigt allerdings nicht die in bestimmten Religionen jeweils geglaubten Inhalte. Für diese wende ich mich nun dem jüdisch-christlichen Kulturkreis zu. Dabei möchte ich zunächst einen Blick auf die biblischen Grundlagen werfen, mit dem ein Eindruck davon gewonnen werden kann, inwieweit Friede und Unfriede für die Sphäre von Judentum und Christentum bereits im Fundament der beiden Religionen angelegt sind.
- Judentum
a) Im Alten Testament finden wir bekanntermaßen die Zehn Gebote (Ex. 20, 2-17; Deut. 5, 6-21) als einen kleinen Ausschnitt aus den weitreichenden Regulierungen des Lebens. Hierin liegt eine inhaltliche Vorgabe für die innerweltliche Gesetzgebung – beziehungsweise eine Sakralisierung alter, innerweltlicher und für gut befundener Regeln, die als „Gottes Willen entsprechend“ verstanden und sodann auch von anderen Rechtsordnungen übernommen worden sind.
Dieser „Regeln setzende“ Gott wird von Israel als großer Befreier verstanden und verehrt, wie es in dem uralten Lied der Mirjam zum Ausdruck kommt (Ex. 15, 21).
- b) Nicht übernommen und nicht einmal in Israel praktiziert worden, sind hingegen die Anordnungen, die sich auf das Wirtschaftsleben bezogen haben (Lev 25).
- c) Massive, gegenwartsrelevante Probleme heraufbeschworen hat schließlich die im Buche Exodus gleich zweimal vorkommende Landverheißung Jahwes:
Nach diesen Bibelstellen erklärt der Gott Israels:
„Ich bin herabgestiegen, um sie [das Volk Israel, J.P.] der Hand der Ägypter zu entreißen und aus jenem Land hinauszuführen in ein schönes, weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig fließen, in das Gebiet der Kanaaniter, Hetiter, Amoniter, Perisiter, Hiwiter und Jebusiter“ (Ex 3, 8).
Und drei Kapitel weiter bestätigt Jahwe (Ex 6, 4):
„Ich führe euch in das Land, das ich Abraham, Isaak und Jakob unter Eid versprochen habe. Ich übergebe es euch als Eigentum, ich, der Herr“ (Ex 6, 8).
Ganz offensichtlich war das betreffende Gebiet schon zur damaligen Zeit keineswegs menschenleer, sondern von Kulturvölkern besiedelt. Israel behauptete aber, als Gottes Volk dieses Land von höchster Hand autoritativ geschenkt erhalten zu haben.
Hier haben wir es mit einer religiösen Fixierung eines Rechtsanspruches zu tun, der von orthodoxen Juden bis heute als unaufgebbar angesehen wird. Soweit und solange sich Israel als „Judenstaat“ versteht, ist daher für die Träger und Verteidiger jener göttlichen Offenbarung eine innerweltlich-rationale Interessenabwägung mit Bezug auf dieses Gebiet ausgeschlossen.
Dabei ist die Friedenssehnsucht Israels ebenfalls aus dem Alten Testament zu belegen: Jesaja hat einen endzeitlichen Friedenszustand ausgemalt, dessen bildliche Darstellung sich die Sowjetunion zu eigen gemacht hat (Jes 2, 4; Micha 4, 3) [10]. Ebenfalls bei Jesaja stehen wunderbare, von Händel vertonte Verse auf den Messias, die diesen als ersehnten Fürsten des Friedens bezeichnen (Jes. 9, 5-6) [11].
- Christentum
Das Christentum hat die rituellen Vorschriften des Judentums überwunden. Die – modern ausgedrückt – „völkerrechtlichen“ Ansprüche Israels waren für Christen sowohl angesichts der faktischen Machtverhältnisse im Römischen Reich als auch aufgrund ihres nationenübergreifenden Bekenntnisansatzes irrelevant. Ausgebaut wurde dagegen die Individualethik, wobei die relativ späten Evangelisten Matthäus und Lukas die einschlägige Logienquelle in unterschiedlicher Weise wiedergeben beziehungsweise fortgeschrieben haben.
Für das spätere Verhältnis zwischen Kirche und politischer Ordnung müssen wir auch die Äußerungen neutestamentlicher Autoren zur öffentlichen Gewalt zur Kenntnis nehmen, wobei sich recht unterschiedliche Haltungen zeigen.
- Mit den beim Evangelisten Johannes überlieferten Worten Jesu zu Pilatus „Mein Reich ist nicht von dieser Welt“ (Joh 18, 36-38), kann man an Weltabgewandtheit und politisch-gesellschaftliches Desinteresse der Christen denken.
- In eine ähnliche Richtung weist ein wörtliches Verständnis der Bergpredigt mit der Seligpreisung der Sanftmütigen, Friedfertigen, um der Gerechtigkeit willen Verfolgten (Mt 5, 5-10): Die Makarismen geben eine Verhaltensrichtung an, die innerweltlichem Machtstreben entgegengesetzt ist. Ziel des menschlichen Strebens sei das Himmelreich als Ort der Erfüllung. Menschlichen Richtern und Gerichtsdienern traut Matthäus dagegen wenig Gutes zu (Mt 5, 25).
- In Jesu Antwort auf die Frage der Legitimität von Steuern kommt eine andere Haltung zur politischen Macht zum Ausdruck, als Jesus mit Hinweis auf die Steuermünze den Rat gibt, die faktische Macht der Fremdherrscher zu respektieren, wenn daneben Gott die Ehre gegeben wird (Mt 22, 15-22).
- In Parallele dazu lesen wir Paulus: „So gebet nun jedermann, was ihr schuldig seid: Steuer, dem die Steuer gebührt; Zoll, dem der Zoll gebührt; Furcht, dem die Furcht gebührt; Ehre, dem die Ehre gebührt“ (Röm 13, 7).
- Paulus macht zur Begründung dieser Haltung jedoch recht weitgehende Ausführungen über die weltliche Herrschaft: „Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit ohne von Gott; wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott verordnet. Wer sich nun der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt Gottes Ordnung; die aber widerstreben, werden über sich ein Urteil empfangen. Denn die Gewalt haben, sind nicht bei den guten Werken, sondern bei den bösen zu fürchten. Willst du dich aber nicht fürchten vor der Obrigkeit, so tue Gutes; so wirst du Lob von ihr haben. Denn sie ist Gottes Dienerin dir zugut. Tust du aber Böses, so fürchte dich; denn sie trägt das Schwert nicht umsonst: sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe über den, der Böses tut“ (Röm 13, 1-4).
- Auch Lukas sieht positive Aspekte an der Staatsgewalt: In der Apostelgeschichte beschreibt er, wie Paulus von einer aufgebrachten Menge verfolgt und mit dem Tode bedroht wird. Der mit seinen Soldaten herbeigeeilte Befehlshaber der römischen Besatzungstruppen verhindert durch seine Anwesenheit eine Lynchjustiz und ermöglicht Paulus, zum Volk zu sprechen. – Militärpräsenz sichert hierbei die Predigt (Apg Kap. 21, 27- Kap. 22, 30).
- Allerdings zeigt sich Lukas nicht unkritisch gegenüber dem Staat. Als die Apostel aus dem Gefängnis entkommen waren und entgegen der Anweisung des Hohen Rates im Tempel ihre Botschaft von Jesus Christus verbreiten, beharrt Petrus darauf: „Man muß Gott mehr gehorchen als den Menschen“ (Apg 5, 29). Öffentliche Gewalt findet also ihre Grenze an Gottes Gebot.
- Im Magnifikat der Maria gibt Lukas einen Hinweis auf Gottes Macht gegenüber den Mächtigen der Welt, wobei dieses Lied neben der Macht auch die – spezifisch lukanische – soziale Komponente thematisiert, wenn Maria singt: „Er stößet die Gewaltigen vom Thron und erhebet die Niedrigen. Die Hungrigen füllet er mit Gütern und läßt die Reichen leer“ (Lk 1, 51-53) – das Problem der Gerechtigkeit!
- Dem Bild des geordneten Staates diametral entgegengesetzt ist bekanntlich das Tier aus dem Abgrund in der Offenbarung des Johannes: Ein Träger von Macht, der Gott lästert und Menschen verführt. Zur Zeit der Entstehung auf das Römische Reich gemünzt, ist dieses Bild im 20. Jh. auf totalitäre Staatswesen bezogen worden (Offb Kap. 13-14)[12].
- Das harte Wort Jesu, er bringe keinen innerweltlichen Frieden (Mt 10, 34), bleibt interpretationsbedürftig, ist aber im Zusammenhang mit der Verkündung des Reiches Gottes zu sehen. Die generelle Friedensbotschaft Jesu Christi hebt es nicht auf.
- Konsequenzen grundlegender christlicher Lehren für die Haltung der westlichen Kirchen zu Politik und weltlicher Gewalt
Insbesondere die Szene aus der Apostelgeschichte gibt Anhaltspunkte für die weitere Entwicklung des Verhältnisses zwischen weltlichen und kirchlichen Strukturen in der Zeit nach dem Ende der Verfolgungen von Christen: Papst Gelasius I vertrat gegenüber dem oströmischen Kaiser Anastasios I die Auffassung, daß allein der Kirche „auctoritas“ zukomme, wohingegen das Imperium lediglich „potestas“ für sich in Anspruch nehmen könne[13]. Beide Seiten – weltliche und geistliche Gewalt – wurden indes gedacht als gemeinsamer Herrschaftsverband der Christenheit, waren aufeinander bezogen und wurden beide als „Heilsanstalten“ verstanden: „Aufgabe des Reiches war die Sicherung des Friedens als der Grundlage der Heilsordnung. Der weltliche Friede wurde vom Reich, der göttliche von der Kirche verwaltet“[14]. Der Investiturstreit des Hochmittelalters markiert hierzu den Höhepunkt des Konflikts[15]. Er endet mit einer Neuordnung des Verhältnisses:
„Was als Entwertung gedacht war, um kaiserliche Herrschaftsansprüche im Bereich der ecclesia abzuwehren, wurde in der unaufhebbaren Dialektik geschichtlicher Vorgänge zur Emanzipation: Der Investiturstreit konstituiert Politik als eigenen, in sich stehenden Bereich; sie ist nicht mehr einer geistlichen, sondern einer weltlichen, das heißt naturrechtlichen Begründung fähig und bedürftig“, schreibt Ernst-Wolfgang Böckenförde[16]. Diese Sicht bezeichnet allerdings einen spezifisch katholischen Standpunkt: Da das kirchliche Lehramt seine Zuständigkeit für die Auslegung des Naturrechts reklamiert, ändert sich nach evangelischer Auffassung nur der Modus der Ausübung kirchlicher Superiorität über die weltliche Herrschaftsgewalt, nicht die beanspruchte Überordnung als solche.
Hinsichtlich der Erkennbarkeit von „Naturrecht“ oder „Sittengesetz“ in der Welt nach dem „Sündenfall“ bestehen die bekannten Auffassungsunterschiede zwischen katholischer und evangelischer Seite. Weder der dissonante – manche würden vermutlich sagen: kakophonische – Chor evangelischer Auffassungen noch die naturrechtlich basierte katholische Position bezeichnen daher eine gesamtchristliche Ansicht.
Ungeachtet der Differenzen in der theoretischen Argumentationsbasis können wir festhalten: Es gibt im Bereich der westlichen Christenheit einerseits eine institutionelle Problematik hinsichtlich ihres Verhältnisses zur weltlichen Macht, heute können wir sagen: zur staatlichen Gewalt, andererseits inhaltliche Anforderungen an die Ausgestaltung des Zusammenlebens als Konsequenz inhaltlicher Gebote christlicher Ethik.
Unter den „westlichen Demokratien“ existieren unterschiedliche Ordnungsmodelle für das Verhältnis zwischen Staat und Kirchen. Grundsätzlich wird aber die autonome Willensbildung jeweils wechselseitig respektiert.
Für den Dialog zwischen westlichen und östlichen Kirchen ist als weiteres Moment die Stellung des Individuums zu beachten: In der Neuzeit kommt – seit dem Jesuitenzögling René Descartes – dem einzelnen Gläubigen eine persönliche Position im Glauben zu – wie auch immer diese konfessionell beschrieben werden mag. Daher ist der Christ nach westlicher Auffassung grundsätzlich als ein „coram deo“ stehender, aber „coram mundo“ handelnder Mensch zu verstehen[17].
Konkrete Beispiele für den Einsatz von Christen sind vielfältig:
Die Abschaffung von Sklavenhandel und Sklaverei ist im britischen Weltreich von Methodisten gefordert und durchgesetzt worden. Weniger rühmlich verlief deren Kampf gegen den Alkohol[18]. Doch ohne die Aktivitäten der großen Kirchen insbesondere im caritativen Bereich – Hospitäler, Waisenhäuser, Kranken- und Altenpflege –, in Bildung, Kultur und Entwicklungshilfe wären die heutigen Profile der Daseinsvorsorge westlicher Demokratien kaum vorstellbar.
Auch scheint es mir kein Zufall zu sein, daß die klassisch-horizontale staatsrechtliche Dreiteilung der Staatsgewalt von Montesquieu im christlich geprägten Europa seiner Zeit ohne jede Ableitung als allgemeingültig behauptet werden konnte: „Il y a dans chaque État trois sortes de pouvoirs …“[19]. Dies ist zwar aufklärerisches Gedankengut, aber eben einer Aufklärung in einem kulturell christlichen Kontext. Wenn also eine Dreiteilung staatlicher Gewalt ohne nähere Begründung plausibel erscheint, kann die Erklärung mit dem Religionssoziologen Peter L. Berger wohl darin gefunden werden, dass sie unserer „Plausibilitätsstruktur“ entspricht[20]: Die Dreiteilung staatlicher Gewalt korrespondiert mit der Trinitätslehre. Mir scheint insoweit eine unmittelbare politische Systemrelevanz der Einbettung eines Menschen in seine religiöse Umwelt gegeben zu sein[21]. Und das ist in freiheitlich-rechtsstaatlichen Demokratien zum Segen geworden!
Während im Mittelalter Kreuzzüge als Gott wohlgefällig ausgegeben worden sind, der Dreißigjährige Krieg von den militärischen Führern der Streitparteien mehr oder weniger stark mit religiösen Komponenten gerechtfertigt worden ist und sich auch der Nordirlandkonflikt unserer Tage schändlicher Weise in einem konfessionellen Gewand präsentiert, gibt es doch – Gott sei Dank! – auch klare Beispiele für ein Engagement beider westlichen Kirchen zur Wahrung oder Wiederherstellung von Frieden und Gerechtigkeit in höchst heiklen Situationen.
- So hat etwa eine Intervention Papst Johannes Pauls II. die Befriedung eines scharfen Konflikts zwischen Chile und Argentinien herbeiführen können[22].
- Der Einsatz von Geistlichen beider Konfessionen hat wesentlich dazu beigetragen, die Revolution in der DDR friedlich zu halten, nachdem zuvor katholische Geistliche in Polen und evangelische Geistliche im anderen Teil Deutschlands der jeweiligen Systemopposition ein Dach geboten hatten[23].
- Die Lage der orthodoxen Kirchen
Wie aber erklärt sich dann die heutige kirchlich-politische Situation in Russland? Zur Beantwortung dieser Frage müssen wir die orthodoxe Kirche wie auch Russlands staatliche Gewalt betrachten.
Die Orthodoxie hat über die letzten anderthalb Jahrtausende eine andere Entwicklung genommen als die westlichen Kirchen. Samuel Huntington hat diese Unterschiedlichkeit in seinem Buch „The Clash of Civilizations“ aufgegriffen und kartiert[24]. Während in Jugoslawien kriegerische Auseinandersetzungen in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts tatsächlich an der Grenzlinie zwischen West- und Ostrom ausgebrochen waren, ist der gegenwärtige Krieg in der Ukraine zwischen zwei Ländern innerhalb der orthodox geprägten Sphäre mit Huntingtons Ansatz offenkundig nicht zu erfassen.
4.1 Die orthodoxe Kirche
Die heutigen orthodoxen Kirchen beziehen sich auf das Erbe der griechischsprachigen Kirchenväter und die byzantinische Tradition. Diese unterscheidet sich von der westlichen recht deutlich. Hans von Campenhausen hat dazu geschrieben[25]:
Das griechische Christentum kennt kein Ringen zwischen Kirche und Staat im abendländisch-mittelalterlichen Sinne. Wenn es auch hier zu Kämpfen um die Macht kommt, so handelt es sich regelmäßig immer nur um die hierarchische Macht innerhalb der Kirche. Auch die größten Bischöfe haben niemals den Anspruch erhoben, in staatlich-politischen Fragen mitzureden oder die Entscheidung zu fällen. Es ist vielmehr der Kaiser als christlicher Inhaber der höchsten irdischen Gewalt, der seinerseits die Dinge der Kirche ordnet und überwacht. Nur im innersten geistlich-priesterlichen Bereich sind seinem Handeln grundsätzlich Grenzen gesetzt; aber das hindert ihn nicht, im Streit der Parteien einzugreifen und für gewöhnlich mit seiner Macht dann auch den Ausschlag zu geben.
Ihr post-kommunistisches Selbstverständnis hat die Russisch-Orthodoxe Kirche im August des Jahres 2000 in ihrem Dokument zu den Grundlagen ihrer Sozialdoktrin kirchenamtlich verbindlich formuliert[26]. Dort heißt es:
Die Kirche ist ein gottmenschlicher Organismus. Als Leib Christi vereinigt sie in sich zwei Naturen – die göttliche und die menschliche – mit den ihnen eigenen Handlungsweisen und Willen. … Namentlich die gottmenschliche Natur der Kirche ermöglicht die gnadenreiche Umwandlung und Reinigung der Welt (Sozialdoktrin I.2, S. 12).
Bei einem solch mythischen Verständnis der Kirche tritt diese nicht institutionell dem Staat gegenüber, sondern hat zunächst eine besondere Beziehung zum Volk. Zum einen sagt die russisch-orthodoxe Kirche unter Berufung auf den Römer- und den Kolosserbrief (Sozialdoktrin II.1, S. 16):
Durch sein Blut erlöste Christus uns ‚Menschen für Gott (…), aus allen Stämmen und Sprachen, aus allen Nationen und Völkern‘ (Offb 5.9). Ihrem Wesen nach ist die Kirche von universalem und folglich übernationalem Charakter.
Doch im nächsten Abschnitt wird erläutert:
Der universale Charakter der Kirche bedeutet allerdings nicht, daß die Christen kein Recht auf nationale Eigenart und nationale Selbstverwirklichung hätten. Im Gegenteil, die Kirche verbindet in sich das universale mit dem nationalen Prinzip. … Auch in dem Bewußtsein, Bürger eines himmlischen Vaterlandes zu sein, dürfen die orthodoxen Christen ihre irdische Heimat nicht vergessen (Sozialdoktrin II.2, S. 18).
Dies wird unter Hinweis auf die Tradition der russischen Orthodoxie näher ausgeführt:
Die kulturellen Unterschiede der einzelnen Völker finden im liturgischen und weiteren kirchlichen Wirken wie auch in den Besonderheiten der christlichen Lebensführung ihren Niederschlag. All dies erschafft die nationale christliche Kultur.
Unter den Heiligen, die von der Orthodoxen Kirche verehrt werden, erwarben sich viele Ruhm aufgrund der Liebe und Ergebenheit zu ihrem irdischen Vaterland (ebd.).
Im nächsten Abschnitt wird die russisch-orthodoxe Kirche deutlicher:
Der christliche Patriotismus bezieht sich in gleicher Weise auf die Nation als ethnische Gemeinschaft als auf die Gemeinschaft der Staatsbürger. Der orthodoxe Christ ist aufgerufen, sein Vaterland, im Sinne eines bestimmten Territoriums, zu lieben, desgleichen seine über die Welt verstreuten Blutsbrüder. …
Insoweit kommt es dann auf die Definition von Vaterland und Blutsbrüdern an, wozu ich an die angebliche „Sammlung russischer Erde“ durch die Zaren erinnere. Das Konfliktpotential – selbst gegenüber anderen Ländern mit mehrheitlich orthodoxer Bevölkerung, aber eigenem Nationalbewusstsein – ist dabei offensichtlich.
Der Patriotismus des orthodoxen Christen soll tätig sein. Er äußert sich in der Verteidigung des Vaterlands gegen den Feind, in der Arbeit zum Wohle der Heimat, im Einsatz für das öffentliche Leben, einschließlich der Teilnahme an den Angelegenheiten der Staatsverwaltung. Der Christ ist dazu aufgefordert, die nationale Kultur und das nationale Selbstbewußtsein zu wahren und weiterzuentwickeln (Sozialdoktrin II.3, S. 19).
Das kirchliche Ziel ist ein „orthodoxes Volk“. Dabei wird „Volkskirche“ zu „Nationalkirche“. Zugleich ist die orthodoxe Kirche als „gottmenschlicher Organismus“ durch seine „historisch gewachsene Komponente“ mit dem Staat in Berührung gekommen und wirkt mit ihm zusammen.
Aufgrund ihrer sakramentalen Natur sei in der Kirche als „Leib Christi“ „weder Böses noch ein Schatten der Finsternis zu finden“. Mit dem modernen säkularen Staat gebe es nur bereichsweise beschränkte Berührungen. Die angestrebte Relation zwischen Staat und orthodoxer Kirche ist jedoch gleichwohl von der Tradition bestimmt, die ein Idealbild der Kirche-Staat-Beziehung entwickelt hat.
So heißt es: Die „ideale Form“ dieser Beziehung könne „nur in einem Staat hervorgebracht werden, der die Orthodoxe Kirche als das höchste Heiligtum des Volkes anerkennt – mit anderen Worten: in einem orthodoxen Staat“ (Sozialdoktrin III.4, S. 25). Damit haben wir dann die Beziehung: Die makellose orthodoxe Kirche erzieht eine orthodoxe Nation für einen orthodoxen Staat. Und dieser Staat ist im Falle Russlands über mehr als 500 Jahre ein expandierendes Gebilde! [27]
Unter Berufung auf byzantinische Regelungen schreibt die russisch-orthodoxe Kirche:
In ihrer Gesamtheit erhielten diese Grundsätze die Bezeichnung Symphonie von Kirche und Staat. Ihr Wesen besteht in gegenseitiger Zusammenarbeit, Unterstützung sowie Verantwortung unter Nichteinmischung in die jeweiligen, ausdrücklich vorbehaltenen Kompetenzbereiche (Sozialdoktrin II.3, S. 19).
Danach sucht der Staat die moralische Unterstützung der Kirche, wofür die Kirche vom Staat hinsichtlich ihrer Wirkungsmöglichkeiten gefördert werde. Hierzu führt die russisch-orthodoxe Kirche eine Formulierung aus dem 9. Jahrhundert an:
Die weltliche Macht und die Geistlichkeit verhalten sich zueinander wie Leib und Seele und sind für die staatliche Ordnung ebenso unentbehrlich wie Leib und Seele im lebendigen Menschen. In der Verbindung sowie dem Einvernehmen zwischen ihnen liegt das Staatswohl begründet (Sozialdoktrin III.4, S. 26).
Während diese Symphonie in Byzanz „nie in reinster Form“ bestanden habe, seien die Verhältnisse im russischen Zarenreich im allgemeinen „durch größere Harmonie“ gekennzeichnet gewesen – sieht man von Ivan dem Schrecklichen und protestantischen Störungen ab (ebd. S. 27).
Bei einer solch symbiotisch gedachten Beziehung zwischen der reinen, wahren, „unfehlbar die Wahrheit Christi“ verkündigenden Kirche (Sozialdoktrin III.5, S. 31) und dem sie schützenden Staat ist für konkurrierende Auffassungen kein Raum.
Die Entwicklung des Prinzips der Gewissensfreiheit ist ein Beleg dafür, daß heutzutage die Religion von einer ‚öffentlichen‘ zu einer ‚privaten‘ Angelegenheit des Menschen geworden ist. An sich ist diese Entwicklung ein Beweis für den Zerfall des geistigen Wertesystems, dafür daß der überwiegende Teil der Gesellschaft, der sich zum Prinzip der Gewissensfreiheit bekennt, des Strebens nach Heil verlustig gegangen ist (Sozialdoktrin III.6, S. 32).
In scharfem Kontrast zu der persönlichen Glaubenszuschreibung in der westlichen Lesart ist der Glaube hier Sache eines Kollektivs, in das sich der Gläubige willig eingliedern soll. Wenn dagegen ein Staat individuellen Auffassungen freien Lauf läßt, kann er nicht auf die Sympathie der russisch-orthodoxen Kirche rechnen; Kirchen, die sich mit einem derartigen Verfall identifizieren, frönen dem Hochmut des Einzelnen[28].
Allerdings sollte man nicht übersehen, daß auch die russisch-orthodoxe Kirche in ihrer Sozialdoktrin Linien zeichnet, deren Überschreitung dem Staat nicht gestattet sei und die eine kritische Haltung zur gegenwärtigen Aggression Russlands gegenüber der Ukraine angezeigt erscheinen lassen könnten. Denn als Kooperationsbereiche zwischen Staat und Kirche wird an erster Stelle genannt: „Friedensschaffung auf internationaler, interethnischer sowie bürgerlicher Ebene“. Demgegenüber zählt zu den Gebieten, auf denen Geistliche und kirchliche Organe „dem Staat ihre Mitarbeit zu verweigern“ haben, unter anderem das „[F]ühren von Bürgerkriegen wie eines aggressiven äußeren Krieges“ (Sozialdoktrin III.8, S. 34 f.).
Konkret ist aus dieser prinzipiellen Festlegung allerdings keine Ablehnung der russischen Aggression gegenüber der Ukraine abgeleitet worden. Mitte September 2022 meinte Patriarch Kirill I. vielmehr: Russland erlebe aktuell eine „sehr schwierige Zeit“. Er forderte die Gläubigen auf, jetzt intensiv für Vaterland, Präsident und Armee zu beten, damit Russland, „seine wirkliche Unabhängigkeit von den mächtigsten Kräften“ bewahren könne, „die heute die meisten Länder der Welt beherrschen“[29]. Damit interpretierte der Patriarch den Angriffskrieg als werthaften Konflikt, stellte sich in den Dienst eines an Ruhe im Inneren interessierten autoritären Herrschers, betonte dafür die Abgrenzung gegenüber dem Westen und legitimierte implizit auch ein mögliches Ausgreifen auf andere, unter der Herrschaft fremder Kräfte stehende Gebiete[30]. Unausgesprochen wird man dafür weiterhin das Konzept einer „Sammlung russischer Länder“ als Plausibilitätsstruktur zugrunde legen können. Zugleich stellen sich Fragen hinsichtlich einer gewissen Parallelität zu Israel.
4.2 Religionssoziologisch-politologische Analyse
Die aus der Binnensicht der Orthodoxie als symphonische Harmonie zwischen ihrer Kirche und einem Nationalstaat dargestellte Beziehung wird in der Kirchengeschichte typischerweise als „Caesaropapismus“ bezeichnet: eine hegemoniale Stellung des weltlichen Herrschers über die dominante organisierte Religion eines Landes, wie sie jedenfalls für die russisch-orthodoxe Kirche seit dem 16. Jahrhundert unter den Zaren bestanden hat[31]. Im republikanischen Russland fehlt die religiöse Funktion des Präsidenten. Wenn jedoch Präsident Putin als weltliches Staatsoberhaupt den Patriarchen Kirill mit dem „Orden des Heiligen Apostels Andreas des Erstberufenen“ – dem höchsten staatlichen Orden – auszeichnet[32], erkennt man die gezielte Anknüpfung an frühere Verhältnisse. Nun handelt es sich allerdings um eine instrumentalisierte Variante der Religionsausübung.
Die christliche Kirche wurde für Zwecke des Herrschaftsapparats politisiert, dienstbar gemacht für einen weltlichen Führer[33]. Eine solche „politisierte Religion“ ist indes deutlich zu unterscheiden von einer „Politischen Religion“ (siehe Graphik), hinter der sich eine Weltanschauung verbirgt[34].
Graphik: Real existierende Modelle für Staats-Kirchen-Beziehungen[35]
Denn als „Politische Religion“ werden Bewegungen bezeichnet, deren Ausgangspunkt in der politischen Sphäre zu verorten ist. Sie reflektieren keine – dem Menschen entzogene – göttliche Realität, sondern sind von politischen Führern für deren innerweltliche Zwecke initiiert. Das Etikett „religiös“ kann diesen Phänomenen daher nur bei Verwendung eines „funktionalen“ Religionsbegriffs angeheftet werden. Insoweit stehen „Politische Religionen“ sozusagen „phänotypisch“ in Konkurrenz zu existierenden Glaubensgemeinschaften. Aus deren Perspektive, die von sich aus ein substantielles Verständnis von Religion vertreten, handelt es sich bei „Politischen Religionen“ dagegen um zutiefst antireligiöse Erscheinungen.
Konkret kann man mit „Politischer Religion“ manche Züge des Nationalsozialismus wie nächtliche Aufmärsche, Verehrung von Märtyrern, Fahnenweihen und Grußrituale ansprechen. Im ehemals kommunistischen Machtbereich haben wir es mit einer gezielten Zerstörung von Kirchen und Propagierung des Atheismus, dem Totenkult um Lenin, Schauprozessen als gewaltsamen Reinigungsritualen und gleichfalls mit Aufmärschen unter Mitführung von Bildern und Parolen zu tun.
Die Politisierung einer vorhandenen Religion hat größte Erfolgsaussichten bei einer Koinzidenz des Verbreitungsgebietes der Glaubensrichtung mit der Ausdehnung einer Nation – bei sodann ethnischer und konfessioneller Abgrenzung nach außen.
Eine „Politische Religion“ wird dagegen durch ein totalitäres Regime in einem Staat erst geschaffen. Sie ist daher zum Untergang verurteilt, wenn das politische System zusammenbricht.
Legen wir diese Kategorien zugrunde, ergibt sich für Russland eine Abfolge von
- einer mit einem traditional-monarchischen System verwobenen orthodoxen christlichen Kirche;
- Unterdrückung, dann Duldung der Orthodoxie bei atheistischer Staatspropaganda mit kommunistischer Politischer Religion;
- nachfolgend Annäherung an den Status quo ante in Form einer politisierten orthodox-christlichen Religion.
Das seit 1990 wiedererstandene Arrangement zwischen orthodoxer Kirche und Russland als Staat bietet aus Sicht der herrschenden Eliten Vorteile für beide Seiten[36]:
- Die zuvor unterdrückte Kirche kann sich als Bewahrerin der Traditionen des Landes präsentieren und genießt einen privilegierten Status gegenüber sämtlichen anderen religiösen Gruppen.
- Das autoritäre politische System erhält eine substantielle, nicht auf Verfahren, sondern auf ein Gemeingut gegründete Legitimierung seitens des religiösen „Establishments“.
Vom Patriarchen zum Präsidenten gesprochen, hört sich das dann konkret so an[37]:
Gott hat Sie an das Steuer der Macht gestellt, damit Sie einen Dienst besonderer Wichtigkeit und großer Verantwortung für das Schicksal des Landes und des Ihnen anvertrauten Volkes leisten.
Mit der Invasion in die Ukraine bekämpft Russland unter Putin nach Kirills Interpretation die unwerthafte Kultur westlicher Prägung – ein segensreiches Unterfangen!
Der Krieg in der Ukraine sei gerechtfertigt als ein Kampf „gegen das Böse“ und gegen pervertierte westliche Werte, wie Kirill am Beispiel eines „Schwulenstolzes“ ausgeführt habe[38]. Die Invasion in der Ukraine dokumentiere danach die Ablehnung der „so genannten Werte“ derer, „die die Weltmacht beanspruchen“. Die ukrainischen Soldaten sollen dagegen Pressemeldungen zufolge aus Sicht des Patriarchen „Kräfte des Bösen“ sein, so dass russische Soldaten, die im Kriege fallen, den Zugang zu „Gottes Reich“ erhielten[39].
Das bedeutet:
- Nach der Ersatzreligion des Kommunismus liefert nun die staatlich privilegierte Orthodoxie eine Ersatzideologie.
- Die traditionelle Selbstidentifikation der orthodoxen Kirche mit russischen Staatsinteressen – einschließlich der „Sammlung russischer Erde“ – hält an.
- Der Ritus der rechten Gottesverehrung als Kernstück des orthodoxen Glaubens bleibt erhalten.
- Die gesellschafts-, außen- und sicherheitspolitisch relevanten Inhalte aber werden in Harmonie mit dem Herrscher im Kreml bestimmt.
Und damit haben wir die Herleitung der russisch-orthodoxen Position zum Krieg gegen die Ukraine.
[1] Arnulf Michaelis: Brief an den Verfasser vom 1.9.2022. – Anknüpfungspunkt: Jürgen Plöhn: „Wer glaubt, denkt weiter“, F.A.Z. Nr. 137 vom 15.6.2022, S. 5. Die Überschrift nimmt eine Formulierung Helmut Thielickes auf.
[2] Christoph Elsas: Religion, in: Historisches Wörterbuch der Philosophie (HWbPh), hrsg. von Joachim Ritter/Karlfried Gründer, Bd. 8, Darmstadt 1992, S. 711 (631-714).
[3] Wilhelm Peter Schneemelcher: Religion, in: Evangelisches Staatslexikon (EvStL), Neuausg., hrsg. von Werner Heun/Martin Honecker/Martin Morlok/Joachim Wieland, Stuttgart 2006, Sp. 2000 (1995-2004).
[4] Heinz Robert Schlette: Religion, in: Handbuch philosophischer Grundbegriffe (HdbphGrdb), Bd. 5 München 1974, S. 1233-1237. – Das Historische Wörterbuch der Philosophie verwendet nicht weniger als 83 doppelspaltige Seiten auf den Begriff „Religion“, dann folgen weitere 69 Seiten zu verwandten Stichworten.
[5] Wilhelm Peter Schneemelcher, loc. cit., Sp. 1995.
[6] Wilhelm Peter Schneemelcher, ebd., Sp. 1996-1997.
[7] Stephanie Müller/Friedemann Schrenk: Speere, Schlehen und Schmucksteine. Vom Leben und Sterben der Neandertaler, in: Natur und Museum, Bd. 136, Nr. 5/6, 2006, S. 103 f.
[8] John H. Kautsky (Hrsg.): Die materialistische Geschichtsauffassung. Dargelegt von Karl Kautsky. Gekürzte Ausg., Berlin/Bonn 1988, S. 173 f.; Georg Klaus/Manfred Buhr (Hrsg.): Marxistisch-leninistisches Wörterbuch der Philosophie, Bd. 3, Stichwort „Religion“, S. 1047 (1046-1052).
[9] Ernst Troeltsch: Die Selbständigkeit der Religion, in: Zeitschrift für Theologie und Kirche, 5. Jg., 1895, S. 406 f.
[10] Text: „Das Wort, das Jesaja, der Sohn des Amoz, in einer Vision über Juda und Jerusalem gehört hat. … Er spricht Recht im Streit der Völker, er weist viele Nationen zurecht. Dann schmieden sie Pflugscharen aus ihren Schwertern und Winzermesser aus ihren Lanzen. Man zieht nicht mehr das Schwert, Volk gegen Volk, und übt nicht mehr für den Krieg.“ – Abbildung im Internet bei Wikipedia zu finden unter: Schwerter zu Pflugscharen – Jewgeni Wutschetitsch – Geschenk der Sowjetunion an die UNO – 1959.jpg.
[11] Jesaja 9, 1: Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. … 5 Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ist auf seiner Schulter; und er heißt Wunder-Rat, Gott-Held, Ewig-Vater, Friede-Fürst; 6 auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er’s stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des HERRN Zebaoth.
[12] Hierzu vor dem Hintergrund eigener Erfahrungen Helmut Thielicke: Theologische Ethik Bd. II.2: Ethik des Politischen, 4. Aufl. Tübingen 1987, S. 72-81.
[13] Hans Hattenhauer: Die geistesgeschichtlichen Grundlagen des deutschen Rechts, 4. Aufl., Heidelberg 1996, S. 17.
[14] Hans Hattenhauer, ebd., S. 18.
[15] Hans Maier: Totalitarismus und Politische Religionen, Paderborn 1996, S. 156.
[16] Ernst-Wolfgang Böckenförde: Recht, Staat, Freiheit, Frankfurt a. M. 1991, S. 96 f.
[17] Hierzu Gerhard Ebeling: Dogmatik des christlichen Glaubens: Prolegomena. Teil 1, 3. Aufl. Tübingen 1987, S. 348 f.; Martin Honecker: Einführung in die Theologische Ethik, Berlin/New York 1990, S. 135, 150 f.; Bernhard Lohse: Luthers Theologie in ihrer historischen Entwicklung und in ihrem systematischen Zusammenhang, Göttingen 1995, S. 335.
[18] Kurt Kluxen: Geschichte Englands, 4. Aufl. Stuttgart 1991, S. 526-531; Rüdiger B. Wersich: Prohibition, in: ders (Hrsg.): USA-Lexikon, Berlin 1996, S. 604 f.; Helmut Klumpjan: Die amerikanischen Parteien, Opladen 1998, S. 261-266
[19] Charles-Louis Secondat, Baron de la Brède et de Montesquieu: De l’ ésprit des lois, 11. Buch, 6. Kapitel, 1. Satz; zit. nach Winfried Steffani: Parlamentarische und präsidentielle Demokratie, Opladen 1979, S. 16, dt. Übersetzung Stuttgart 1994, S. 216.
[20] Peter L. Berger: Auf den Spuren der Engel. Die moderne Gesellschaft und die Wiederentdeckung der Transzendenz, Frankfurt a.M. 1972, S. 61 f.
[21] Zur Relevanz der „embeddedness“: Anthony Giddens: Consequences of Modernity, Cambridge 1990 sowie Jörg Himmelreich: Die russisch-orthodoxe Kirche als Kriegstreiberin, N.Z.Z. IA, 19.11.2024, S. 14.
[22] Markus Weingardt: Religion macht Frieden. Das Friedenspotenzial von Religionen in politischen Gewaltkonflikten, Stuttgart/Bonn 2007, S. 49-66.
[23] Ilko-Sascha Kowalczuk: Endspiel. Die Revolution von 1989 in der DDR, Bonn 2009; Gerhard Rein: Die protestantische Revolution 1987-1990, Berlin 1990; Detlev Preuße: Umbruch von unten. Die Selbstbefreiung Mittel- und Osteuropas und das Ende der Sowjetunion, Wiesbaden 2014, S. 157-160, 507, 514, 516, 518, 520 f.
[24] Samuel P. Huntington: Der Kampf der Kulturen. Die Neugestaltung der Weltpolitik im 21. Jahrhundert, dt. Ausg., 6. Aufl. München/Wien 1997, S. 30 f., 91 (Weltkarte für 1990); hierzu vergleichend: Walter Leisering (Hrsg.): Historischer Weltatlas, 102. Aufl. Berlin 1997 (Lizenzausg. Wiesbaden 2011), S. 28.
[25] Hans Freiherr von Campenhausen: Griechische Kirchenväter, 7. Aufl., Stuttgart u.a. 1986, S. 137.
[26] Die Grundlagen der Sozialdoktrin der Russisch-Orthodoxen Kirche. Deutsche Übersetzung mit Einführung und Kommentar hrsg. von Josef Thesing und Rudolf Uertz, Sankt Augustin 2001.
[27] Hintergründe bei Igor Tschubais: Wie wir unser Land verstehen sollen. Aus dem Russischen übersetzt und herausgegeben von Dietrich Kegler, Aachen 2016, S. 22, 29.
[28] Nikolaj Berdjaev: Das Schicksal Russlands. Übersetzt und herausgegeben von Dietrich Kegler, Baden-Baden 2018, S. 84 f.
[29] Patriarch Kyrill I. ruft zu Gebeten für Putin auf. [Internetseite] Katholisch.de 12.9.2022. – Der Berliner Kirchenhistoriker Heinz Ohme hat auf die „apokalyptische Zeitdeutung“ hingewiesen, seit Beginn dieses Jahrhunderts vom Patriarchen und dessen Umfeld vertreten werde. Während Moskau als das „Dritte Rom“ dem „Antichristen“ Widerstand leiste, zeige sich im Westen dessen verderblicher Einfluss, gefördert durch die Theologie der jahrzehntelang partnerschaftlich mit der russischen Orthodoxie verbundenen EKD. Heinz Ohme: Moskau, der Westen und die Apokalyptik, F.A.Z. Nr. 85 vom 11.4.2022, S. 19.
[30] Roland Benedikter: The Role of Religion in Russia’s Ukraine War. Part 1: A Map of the Situation, in: Zeitschrift für Außen- und Sicherheitspolitik, 16. Jg. (2023), S. 82 (79-100); ders.: The Role of Religion in Russia’s Ukraine War. Part 2: Developments and Perspectives, in: Zeitschrift für Außen- und Sicherheitspolitik, 16. Jg. (2023), S. 178 (173-198).
[31] Jeremy W. Lamoreaux/Lincoln Flake: The Russian Orthodox Church, the Kremlin, and religious (il)liberalism in Russia, in: Palgrave Communications, vol. 4 (2018), article no. 115 (https://doi.org/10.1057/s41599-018-0169-6).
[32] Patriarch Kirill awarded Order of St Andrew the Apostle the First-Called (November 20, 2021, 12:30), http://en.kremlin.ru/events/president/news/67150.
[33] Roland Benedikter, The Role of Religion, Part 1, S. 84; ders.: The Role of Religion, Part 2, S. 181 f.
[34] Juan Linz, Der religiöse Gebrauch der Politik, a.a.O., 130.
[35] Quelle: Juan Linz: Der religiöse Gebrauch der Politik und/oder der politische Gebrauch der Religion. Ersatz-Ideologie gegen Ersatz-Religion, in: Hans Maier (Hrsg.): Totalitarismus und Politische Religionen, Paderborn u.a. 1996, S. 134 (129-154).
[36] Ebenso Roland Benedikter, The Role of Religion, Part 1, S. 85; ders.: The Role of Religion, Part 2, S. 174.
[37] Patriarch ruft zum Gebet auf [70. Geburtstag Wladimir Putins], RP online, 7.10.2022, 18.00 Uhr (https://rp-online.de/politik/ausland/putin-geburtstag-patriarch-ruft-zum-gebet-auf-kadyrow-gratuliert_aid-77961971).
[38] Soziologe: Kirche und Staat in Russland gegen westliche Werte geeint (rom/epd/KNA). 11.3.2022, 18:28 Uhr (Bericht zu Detlef Pollack, https://www.katholisch.de/artikel/33476-soziologe-kirche-und -staat-in-russland-gegen-westliche-werte-geeint).
[39] David Schmitz: Kreml-Narrative: Auf die „Entnazifizierung“ der Ukraine folgt die „Entsatanisierung“, KStA v. 27.10.2022.