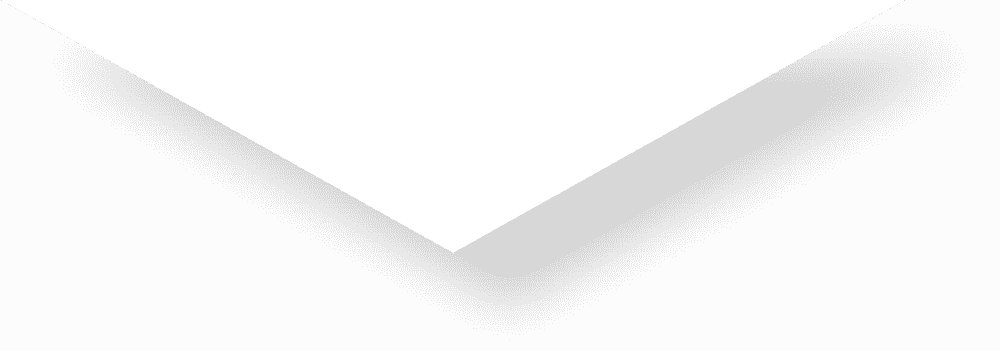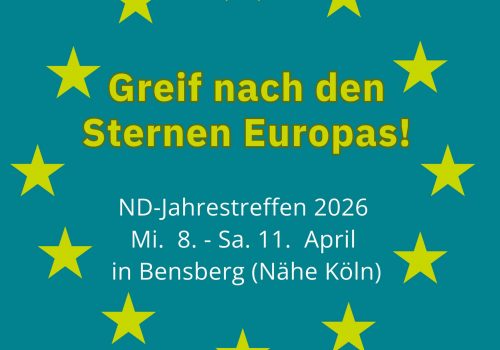Unser Referent beim Zentralkommittee der Katholiken Deutschlands (ZdK) Kurt Schanné hat einen Vortrag beim Thomas Morus Bildungswerk Schwerin gehalten, der leicht verständlich in die Prinzipien der Katholischen Soziallehre einführt. Bearbeitete und gekürzte Fassung des Vortrags
Die Rede vom christlichen Menschenbild hat Konjunktur. Nicht nur die Kirchen nehmen darauf in ihrer Sozialverkündigung Bezug. Auch Vertreter/innen verschiedenste politischer Gruppierungen und Parteien verwenden dieses „Narrativ“ in ihren programmatischen Aussagen und in ihren operativen Vorschlägen. Das Spektrum reicht von der christlichen Rechten beispielsweise in den USA bis hin zu eher links eingeordneten Positionen. Zentrale Begriffe sind dabei Menschenwürde, Freiheit, Gerechtigkeit, Frieden. Die folgenden Ausführungen sollen das christliche Menschenbild von seinen Wurzeln her beschreiben und seine Tragfähigkeit vor allem im Hinblick auf die christliche Sozialethik an einigen Beispielen verdeutlichen.
- Was ist das christliche Menschenbild? – Biblische Stationen
Schauen wir auf die Wurzeln des christlichen Menschenbildes in den beiden „Schöpfungs-“Erzählungen des Ersten Testaments, dann erkennen wir folgende Merkmale:
- Der Mensch ist von der Erde genommen, ein Erdling (Adam)
- Er wird mit Geist (ruach) erfüllt
- Er wird als Mann und Frau geschaffen
- Er ist Abbild Gottes
- Er ist damit „Re-präsentant“ der göttlichen Herrschaft
Ein hoch anspruchsvolles Menschen-Bild, jedoch eingerahmt von der Herrschaft Gottes über die Erde. Von dieser leitet sich die menschliche Herrschaft ab und bleibt zugleich rückgebunden in die Verantwortung gegenüber dem eigentlichen Herrn, dem Schöpfer. Der Mensch, Mann und Frau, erscheint hier als Stellvertreter und
Statthalter Gottes auf der Erde. Er soll sie gestalten, pflegen und bewahren.
Die wohl berühmteste bildliche Darstellung dieses ursprünglichen Verhältnisses von Gott und Mensch findet sich in Michelangelos Bild „Die Erschaffung Adams“ in der Sixtinischen Kapelle in Rom. Dieses Bild, geschaffen in den Jahren nach 1500, zeigt das Gegenüber des Schöpfers und seines Abbilds, des menschlichen Geschöpfs, dargestellt als nackter, sehr muskulöser junger Mann, das Schönheitsideal der damaligen Zeit, der Renaissance.
Eine musikalische Variante dieses Themas aus der Zeit der Klassik bietet das Oratorium „Die Schöpfung“ von Josef Haydn, entstanden zwischen 1796 und 1798. Dort singt der Erzengel Uriel:
Mit Würd´ und Hoheit angetan
Mit Schönheit, Stärk‘ und Mut begabt,
Gen Himmel aufgerichtet steht er da,
Ein Mensch und König der Natur,
Die breit gewölbt erhab´ne Stirn
Verkünd´t der Weisheit tiefen Sinn,
Und aus dem hellen Blicke strahlt der Geist,
Des Schöpfers Hauch und Ebenbild.
Man spürt hier, wenige Jahre nach der Französischen Revolution, die Aufklärung, die den Geist als besonderes menschliches Merkmal hervorhebt. Weil der Mensch ein Geistwesen ist, kommt ihm/ihr in der Natur ein besonderer Rang zu. Er/sie herrscht über die anderen Lebewesen und die ganze Schöpfung.
Aber das ist nur die halbe Wahrheit: die ganz andere Seite des Menschen kommt in den weiteren Kapiteln des Buches Genesis (3-11) zur Darstellung. Der Mensch ist eben nicht nur gut, sehr gut geschaffen, sondern auf abgründige Weise „ambi-valent“.
- Er übertritt das göttliche Gebot.
- Er wird aus dem Paradies vertrieben.
- Das Leben wird zur Qual und endet im Tod.
- Aus Neid geschieht der erste Brudermord.
- Die Bosheit und Gewalt der Menschen endet in der großen Flut.
- Der Turmbau zu Babel führt zur Verwirrung der Sprache
Das ist die Welt, in der wir leben. Sie ist zugleich schön und schrecklich, und zwar wegen uns. Wir sind als geistige Wesen mit Freiheit begabt. Diese Freiheit kann zum Guten neigen, aber auch zum Bösen, von persönlichen Schandtaten bis hin zu monströsen Verbrechen wie dem Holocaust. All dies vermag der Mensch. Wir vermögen das.
Das Christentum verheißt die „Erlösung von dem Bösen“. Gerade deswegen ist es aber auf besondere Weise sensibel für die Bosheit des Menschen. Im Zentrum der Erlösungsgeschichte steht der „leidende Mensch“ Jesus. Er erfährt die Bosheit der Menschen auf sich und trägt sie bis zum bitteren Ende. Er wird geschlagen, gedemütigt und mit einer Dornenkrone gekrönt. So führt ihn Pilatus nach dem Bericht des Johannes-Evangeliums vor und spricht: Sieh, der Mensch! (Joh 19,5)
Man könnte diese Erzählung tragisch nennen, wenn es dabei bliebe. Aber die Dornenkrone und die Kreuzigung ist nicht das Ende. Nach christlichem Glauben überwindet der Gekreuzigte und Begrabene den Tod. Damit stellt er das Bild wieder her, das vom Anbeginn der Schöpfung jedem Menschen eingeprägt war. Der Kolosserbrief nennt ihn das Abbild, die „Ikone“ des unsichtbaren Gottes (1,15). Vor allem in der orthodoxen Tradition spielen die Ikonen eine bedeutende Rolle.
Fassen wir kurz zusammen: Die Komplexität und der Realismus des christlichen Menschenbildes besteht darin, dass er gut, ja sehr gut geschaffen ist, mit Geist und Freiheit begabt, zugleich aber als Täter und Opfer des Bösen erscheint und auf Erlösung angewiesen ist. Durch Kreuz und Auferstehung wird ihm diese Erlösung anfanghaft zuteil. Aber die Vollendung steht aus und bleibt eine Tat Gottes.
- Anfragen
Das ist die christliche Tradition, die sich seit der Neuzeit jedoch kritischen Anfragen ausgesetzt sieht. Längst ist der Mensch aus seiner Zentralstellung im Kosmos herausgerückt. Die Erkenntnisse der Naturwissenschaften führen zu erheblicher „anthropologischer Ernüchterung“. Demnach ist unsere Erde einer von sehr vielen Planeten im Weltall. Extraterrestrisches intelligentes Leben wird nicht mehr ausgeschlossen, sondern immer wahrscheinlicher. Die Evolution des Kosmos, der Erde, des Lebens und nicht zuletzt des Menschen selbst gilt als gesichert. Wir stammen zweifelsfrei von tierischen Vorfahren ab. Aber auch die Sozialwissenschaften und die Psychologie zeigen uns unsere determinierenden Grenzen auf. Auf der anderen Seite könnten neueste Technologien der Genetik, der Robotik und der KI dazu führen, dass wir unser gegenwärtiges Mensch-Sein überschreiten und „on the long run“ zu Mensch-Maschine-Systemen mutieren. Manche Wissenschaftler vertreten ganz offen diese Vision und sprechen von „Trans-Humanismus“. Man fühlt sich an Nietzsches Wort vom „Übermenschen“ erinnert.
- Gegen alle Anfragen: Der Mensch als Person
Was lässt sich hierzu sagen? Zunächst einmal gilt es diese Entwicklungen aufmerksam wahrzunehmen und zu verstehen, denn jede wissenschaftliche Erkenntnis und jede technische Neuerung ist ja selbst Teil der menschlichen Entwicklung. Es sind Menschen mit ihren besonderen Begabungen, die die kulturelle Evolution vorangetrieben haben, von der wir heute leben. Die Erde ist tatsächlich „anthropogen überformt“, wie manche sagen. Andere wie der Nobelpreisträger Paul Crutzen sprechen vom „Anthropozän“, von einer neuen, vom Menschen (anthropos) dominierten geologischen Epoche.
Es kommt also offenbar doch weiter auf den Menschen an. Ohne ihn und an ihm vorbei lässt sich keine Zukunft gestalten. Aber was ist der Mensch, wenn theologische Plausibilitäten wegfallen? Gibt es andere Möglichkeiten, zu einem möglichst breit geteilten Verständnis des Menschen und seiner besonderen Stellung zu kommen?
Wir überspringen aus Zeitgründen die Antike und das Mittelalter und werden bei Immanuel Kant, dem deutschen Meisterdenker, fündig. Kant argumentiert, dass der Mensch im Unterschied zu allen nicht-menschlichen Wesen nicht nur Wert hat. Vielmehr ist er es, der den Dingen Wert verleiht und sie als Mittel für seine autonom gesetzten Zwecke gebraucht. Daher ist der Mensch, wie Kant es nennt, „Zweck an sich selbst“. Er hat seinen Wert aus sich selbst heraus. Er hat Würde! Es verbietet sich also, dass er lediglich zum Mittel für anderes wird. Dementsprechend formuliert Kant den sog. Kategorischen Imperativ als Grundregel der Moral wie folgt: Handle so, dass du die Menschheit in deiner Person als in der Person eines jeden anderen jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchst (Metaphysik der Sitten).
- Menschenwürde und Menschenrechte als Ausgangspunkt jeder sittlichen und politischen Ordnung
Für Christen ist der Mensch Abbild Gottes. Für Philosophen wie Kant ist er „Zweck an sich selbst“. Aber all diese Begriffe bleiben abstrakt und blass, wenn sie nicht durch Erfahrung gedeckt sind. Dass es tatsächlich Menschenwürde und Menschenrechte gibt, wird dort am deutlichsten, wo sie auf krasse Weise verletzt werden. In der Shoa beispielsweise wurde fast ein ganzes Volk ausgelöscht. Andere Genozide sind aus der Geschichte bekannt. Ich erwähne auch das nationalsozialistische Euthanasieprogramm. Aber es muss nicht immer Mord und Totschlag sein. Auch die politische Unterdrückung und die ökonomische Ausbeutung von Menschen in ihren vielfältigen Formen wird als Verstoß gegen Menschenwürde und Menschenrechte empfunden.
Vor diesem Hintergrund haben sich vor rund 250 Jahren erstmals Menschen zu einer Freiheits- und Sozialbewegung zusammengefunden, und zwar nicht in Europa, sondern in Nordamerika. Sie strebten nach politischer Unabhängigkeit vom britischen Empire und nach sozial-ökonomischer Freiheit.
In der Unabhängigkeitserklärung der zunächst 13 Vereinigten Staaten von Amerika vom 04. Juli 1776 heißt es:v
„Wir halten diese Wahrheiten für selbstverständlich, dass alle Menschen gleich geschaffen sind, dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten begabt sind, darunter das Recht auf Leben, auf Freiheit und auf Verfolgung des je eigenen Glücks. Um diese Rechte zu sichern, sind Regierungen unter den Menschen eingerichtet, die ihre gerechte Legitimität aus dem Konsens der Bürger ableiten.“
Wenig später, einige Wochen nach dem Sturm auf die Bastille in Paris, hält die Allgemeine Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte vom 26. August 1789 fest:
„Die Menschen sind und bleiben von Geburt frei und gleich an Rechten. Soziale Unterschiede dürfen nur im gemeinen Nutzen begründet sein. Das Ziel jeder politischen Vereinigung ist die Erhaltung der natürlichen und unveräußerlichen Menschenrechte. Diese Rechte sind Freiheit, Eigentum, Sicherheit und Widerstand gegen Unterdrückung.“
Es soll an dieser Stelle nicht verschwiegen werden, dass die ersten amtlichen Reaktionen der katholischen Kirche keineswegs positiv waren. Obwohl wir heute wissen, dass Teile des katholischen Klerus an der französischen Revolution beteiligt waren, wird Papst Pius VI. in einem Schreiben 1791 deutlich. Er schreibt: „Kann man etwas Unsinnigeres ausdenken, als eine derartige Gleichheit und Freiheit für alle zu dekretieren?“ Man sieht, die katholische Kirche hat seither einen erheblichen Lernprozess durchgemacht.
Ich springe unmittelbar ins 20. Jahrhundert und zitiere aus der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte vom 10. Dezember 1948:
„Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geist der Solidarität begegnen.“
Im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 1949 heißt es in Artikel 1,1:
„Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen, ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.“
Während des Zweiten Vatikanischen Konzils verfasst Papst Johannes XXIII. im Jahr 1963 die Enzyklika „Pacem in terris“ und schreibt dort:
„Der Schutz und die Förderung der unverletzlichen Menschenrechte gehört wesenhaft zu den Pflichten einer jeden staatlichen Gewalt.“
Diese Position wiederholt das Zweite Vatikanische Konzil wortgleich in der Erklärung über die Religionsfreiheit (Dignitatis humanae, Ziff. 6). Ganz auf dieser Linie liegt auch das von Papst Franziskus approbierte Schreiben des Dikasteriums für die Glaubenslehre mit dem sprechenden Titel „Infinita dignitas“: Unendliche Würde. Dort führt das Dikasterium aus, dass jeder Mensch ohne jeden Unterschied als Geschöpf und Abbild Gottes eine unverlierbare Würde besitzt. In dem Schreiben wird diese als „ontologisch“ bezeichnet. Will heißen, sie ist unmittelbar mit dem Sein des Menschen gegeben und gilt unterschiedslos für alle. Das Schreiben bleibt aber dabei nicht stehen. Es spricht auch von der sittlichen Würde und von der sozialen und existentiellen Würde. Die sittliche Würde eines Menschen kann durchaus verloren gehen, indem er sich ganz und gar von Gottes Gebot abwendet. Ebenso kann die soziale und existentielle Würde des Menschen verloren gehen, wenn ihm die elementarsten Lebensvoraussetzungen verwehrt werden oder genommen sind.
- Menschenrechte als Ausfaltung der Menschenwürde
Die bereits genannte Erklärung der Menschenrechte vom Dezember 1948 nennt insgesamt 30 Rechte, die jedem Menschen unterschiedslos zukommen, darunter
- die individuellen wie z.B.auf Freiheit, Leben und Eigentum, aber auch auf Asyl
- die sozialen Rechte wie z.B. auf Arbeit, auf ein Existenzminimum und auf Bildung sowie die
- politischen Rechte, darunter vor allem das allgemeine Wahlrecht (one man – one vote).
- Prinzipien der katholischen Soziallehre
Ich komme nun zu katholischen Soziallehre und ihrer Reflexion über den Menschen, seine Rechte und seine Pflichten. Während der Menschenrechtsdiskurs primär beim Individuum ansetzt, liegt der Akzent der katholischen Soziallehre auf der Gestaltung der Gesellschaft und Wirtschaft Ihre Leitfrage lautet: Welche Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung verdient es, menschlich genannt zu werden? Die Antwort klingt zunächst einfach: die, den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Aber was heißt das?
Hierüber wird in der katholischen Kirche seit 1891 lehramtlich reflektiert. Erstmals thematisiert Papst Leo XIII. in seiner Enzyklika „Rerum novarum“ die sog. Soziale Frage, also das in der Industriegesellschaft vehement auftretende Problem der massenhaften Unterdrückung und Ausbeutung der Arbeiterschaft. Die durch persönliche Freiheit und das Privateigentum geprägte Wirtschaftsordnung wird zwar bejaht, zugleich aber wird die Verantwortung der Unternehmer und des Staates im Sinne eines gerechten Interessenausgleichs betont. Vor allem geht es dabei um den gerechten Lohn, der den Lebensunterhalt sichert – ein sehr aktuelles Thema bis heute.
Als Resümee aus der päpstlichen Soziallehre bis hin zu Franziskus lassen sich folgende Prinzipien für die Gestaltung von Gesellschaft und Wirtschaft erkennen.
Personalität
Übersetzt in die Sphäre von Gesellschaft und Wirtschaft heißt Personalität: die politische Gestaltung der Gesellschaft muss immer den Ausgangspunkt beim einzelnen Menschen, bei seinen Ansprüchen, Rechten und Bedürfnissen nehmen. Politik ist keine „Sozialtechnik“, sondern der Versuch, vom Menschen her Gesellschaft nach allgemein einsichtigen und gerechten Regeln zu gestalten. Dabei gilt immer: Im Zweifel für die Freiheit. Kollektivistische Ideologien werden von der Katholischen Soziallehre zurückgewiesen.
Die dem Personalitätsprinzip am ehesten entsprechende politische Organisationsform ist die Demokratie. Nach heutigem Ermessen ist sie die beste Möglichkeit, menschengemäße Politik zu gestalten, weil sie durch freie und geheime Wahlen und weitere Formen der Partizipation die maximale Möglichkeit freier und gemeinsamer Gestaltung des Gemeinwesens eröffnet.
Neben der Demokratie ist die soziale Marktwirtschaft als Wirtschaftsordnung einer freien Gesellschaft zu nennen. Auch sie setzt beim einzelnen Wirtschaftssubjekt, ob Unternehmer oder Beschäftigter an, stellt zugleich aber Regeln für den wirtschaftlichen Wettbewerb auf. Auch sorgt der Staat als Sozialstaat dafür, dass unsoziale Auswirkungen des wirtschaftlichen Wettbewerbs ausgeglichen werden. Dies geschieht durch Schutzrechte und durch gezielte Umverteilung zu Gunsten der Ärmeren und Schwächeren in der Gesellschaft.
Subsidiarität
Die katholische Soziallehre denkt vom einzelnen Menschen und von den kleinen „Lebenseinheiten“ her, darunter vor allem die Familie. Das bedeutet, dass höherrangige Institutionen, auch und gerade staatliche, nur dann regulativ eingreifen sollten, wenn die Möglichkeiten des Einzelnen, einer kleineren Gruppe oder niedriger Hierarchie-Ebenen alleine nicht ausreichen, eine Aufgabe zu lösen. Dieses Prinzip ist sowohl für die Sozial- und Wirtschaftsordnung als auch für Staatsverständnis von außerordentlicher Bedeutung. Deutschland ist ein föderaler Staat, die Europäische Union ist ein Staatenverbund. In beiden Fällen gilt nach dem Grundgesetz und nach den europäischen Verträgen strikt das Prinzip der Subsidiarität. Das heißt, die Zuständigkeit liegt zunächst immer bei den Bundesländern und ihren Kommunen bzw. bei den EU-Mitgliedstaaten. Nur dort, wo Gesamt-Regelungen zwingend erforderlich sind, beginnt die Zuständigkeit der höheren Ebenen (s. GG Art. 70 und Art. 28). Der Staatsaufbau im demokratischen Gemeinwesen erfolgt somit nach dem Subsidiaritätsprinzip von unten und nicht von oben. Dies konkurriert natürlich auf gravierende Weise mit den gegenwärtigen globalen Problemen, die ein nationales und möglichst auch internationales koordiniertes Handeln erforderlich machen. Eine vernünftige „Konkordanz“ zwischen gestaltender Politik der höheren Verantwortungsebenen und der grundlegenden Verantwortung der unteren Ebenen kann nur gefunden werden, wenn nicht von oben diktiert und dekretiert wird, sondern auf intelligente Weise Spielräume eröffnet werden, innerhalb derer die einzelnen Menschen und die kleineren Einheiten selbst ihren verantworteten Weg finden können.
Solidarität
Der Mensch ist Individuum und zugleich ganz und gar in Gemeinschaft und Gesellschaft eingebunden. Er ist seinem Wesen nach – auch – ein soziales Wesen. Dies schließt die Verpflichtung zu gegenseitiger Unterstützung und Hilfe, insbesondere in Situationen der Not, ein. Eine Gesellschaft kann nur funktionieren, wenn sie sich auf persönliche Solidarität von Mensch zu Mensch, aber auch auf institutionalisierte Solidarität verlassen kann. Ein herausragendes und weltweit beachtetes Beispiel für gelebte institutionelle Solidarität sind die in Deutschland vorbildlich eingerichteten Systeme der Sozialversicherung, der Renten-, Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung, die allerdings angesichts der demographischen Herausforderung zukunftsfest gemacht werden müssen.
Zum Begriff der Solidarität gehört auch das Recht der Koalition und der Bildung von Gewerkschaften zur Durchsetzung der Interessen der arbeitnehmenden Bevölkerung. Es liegt auf der Hand, dass ohne diese Form von Solidarität keine Erfolge im Ringen zwischen Kapital und Arbeit errungen werden können. Die katholische Soziallehre befürwortet mittlerweile ohne jede Einschränkung die Existenz und Tätigkeit von Gewerkschaften einschließlich ihrer „Arbeitskampfrechte“.
Ökologische Nachhaltigkeit
Der Begriff der Nachhaltigkeit wird bisher in den offiziellen päpstlichen Dokumenten kaum verwendet und spielt noch keine dominante Rolle. Gleichwohl ist die Botschaft der bislang letzten Sozialenzyklika „Laudato Si´“ von Papst Franziskus mehr als klar. Die Ausplünderung und Verschmutzung unseres Planeten, das Artensterben und die Erhitzung der Erde muss gestoppt werden, und zwar nicht nur durch individuell verändertes Verhalten, sondern auch durch Politik im großen Stil. Speziell für diese Enzyklika hat sich der Papst intensiv von Wissenschaftlern beraten lassen, darunter auch prominente Fachvertreter aus Deutschland. Die Vorstellung des Textes erfolgte zusammen mit international renommierten Wissenschaftlern. Der betont, dass die Menschheit im Respekt gegenüber der Schöpfung und um ihrer selbst willen einen neuen effizienteren und genügsameren Umgang mit den natürlichen Ressourcen finden muss. Hier ist in gleicher Weise der persönliche Lebensstil wie auch die Offenheit für neue Technologie gefragt. Alles, was hilft, sollte genutzt werden. Dass der Staat auf diesem Feld eine eminente politische Gestaltungsaufgabe hat, ist nicht bestreitbar. Sie sollte aber unter Beachtung der Personalität und Subsidiarität vor allem darin bestehen, Anreize für ökologisch intelligentes Handeln zu geben.
- Konkretion im Handeln
Die hier dargelegten Prinzipien der Menschenwürde, der Menschenrechte und der Sozialethik sind und bleiben: Prinzipien. Im Vorstehenden habe ich einige erste Konkretionen angedeutet. Diese betreffen sowohl das persönliche als auch das politische Handeln. In beiden Fällen muss aber betont werden, dass Prinzipien allein nicht reichen, um zu richtigen Entscheidungen zu kommen. Vielmehr müssen – vor allem in der Politik – weitere Faktoren in die ethische Abwägung einbezogen werden. Zum einen kann es zwischen den Prinzipien selbst Konflikte geben, verschärft durch das Nachhaltigkeitsgebot. Zum anderen müssen die jeweiligen Umstände und die konkrete Situation in die Prüfung hineingenommen werden. Schließlich muss in einer Demokratie ein Weg gefunden werden, das als richtig Erkannte auch mehrheitsfähig zu machen. Hier beginnt die Kunst des politischen Kompromisses. Gerade den Menschen, die als Christen politisch tätig sind, sollte die Verantwortung, die sie tragen, und der Anspruch, unter den sie sich stellen, bewusst sein. Dies gilt für Christen in allen Parteien. Dabei steht eine Partei auf Grund des „C“ öffentlich ganz besonders unter Beobachtung. „Humanität und Ordnung“: so haben einige politische Exponenten diese Aufgabe formuliert. Aufnahme der Menschen, die auf unsere Hilfe und unseren Schutz angewiesen sind, Willkommenskultur für die Menschen, die wir als Fachkräfte dringend brauchen, aber auch Zurückweisung derer, die unseren Staat ausnutzen oder gar gefährden wollen. Der Balanceakt ist äußerst schwierig. Die Menschenwürde und das Asylrecht verlangen zumindest ein faires Verfahren, wohl wissend, dass schon damit das Risiko des dauerhaften, letztlich illegalen Aufenthalts einhergeht. Diese komplexe Thematik eignet sich aber gerade nicht für „völkisch“ aufgeputschte Debatten, sondern verlangt verantwortliches Entscheiden der Politik und einen menschlich angemessenen Vollzug durch die Sicherheits- und Ordnungskräfte.
Ich schließe diesen Vortrag mit einem Gebetstext, der auch Eingang in das Gotteslob (20,1) gefunden hat. Es ist ein Ausschnitt aus dem Gebet der Vereinten Nationen und nimmt noch einmal ganz unmittelbar Bezug auf unser Thema „Christliches Menschenbild“:
Herr, unsere Erde ist nur ein kleines Gestirn im großen Weltall.
An uns liegt es, daraus einen Planeten zu machen,
dessen Geschöpfe nicht von Kriegen gepeinigt werden,
nicht von Hunger und Furcht gequält,
nicht zerrissen in sinnlose Trennung nach Rasse,
Hautfarbe oder Weltanschauung.
Gib uns Mut und Voraussicht,
schon heute mit diesem Werk zu beginnen,
damit unsere Kinder und Kindeskinder einst mit Stolz
den Namen MENSCH tragen. Amen